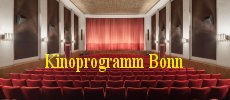Uncategorised
| Schutzmann Streukooche Johann Jakob Hehn 1863 - 1920 Städtischer Nachtwächter, königl.-preuß. Polizeibeamter klein, dick, mit einem "Edamer-Kies-Kopp", auf dem er mühevoll einen viel zu kleinen Helm - Kuletschot genannt - balancierte, mit "Brutschnäuzer", kleinem Knebelbart und treu blickenden "Hundeaugen" - so spazierte der Vertreter preußischer Staatsmacht durch sein Revier, das einen großen Fehler aufwies. Es gab zu viele Kneipen, bei deren Anblick es dem Schutzmann Streukooche schwerfiel, weiterzugehen. Oft genug, wenn er einkehrte und ein paar "Droppe" genommen hatte, wurde er gesprächig und dabei mußte er den Kneipengängern immer wieder die Geschichte erzählen, die ihm zu seinem Namen verholfen hatte. Als früherer Nachtwächter, dem auch viele Hausschlüssel anvertraut waren, hatte Hehn, wie ihmmer, die Bäckergesellen und Lehrjungen im Severinsviertel geweckt. Als er einige Stunden später in einer Backstube aufkreuzte, um "e paar Dröppcher" zu nehmen, verwechselte er in der Dunkelheit einen zur Ausdünstung im Hausflur stehenden Streuselkuchen mit der Fußmatte und schon war das Malheur passiert. "Et wor garnit esu vill verdorve", erzählte Hehn immer wieder. Da sich die Geschichte in Windeseile rundsprach, nannten ihn fortan alle nur noch "Naakswächter Streukooche". Nach der Auflösung des städtischen Nachtdienstes 1894 wurde Hehn in den preußischen Polizeidienst übernommen. Als "Schutzmann Streukooche" wurde er zur stadtbekannten Figur. "Hä wor ne dudgode Kääl" sagten ihm noch nach Jahrzehnten alle nach, die ihn gekannt hatten. |
 |
| Fressklötsch | |
| Orgels Palm | |
| Maler Bock | |
| Bolze Lott | |
| Schutzmann Streukooche | |
| Fleuten Arnöldche | |
  |
| Fleuten ArnoldcheFleuten-Arnöldche Arnold Wenger 1836 - 1902 Straßenmusikant Als Musiker hätte Arnold Wenger sicherlich Karriere machen können, denn er entlockte seiner Querflöte die herrlichsten Töne und Melodien. Doch der Filius des Weinwirtes Theo Wenger, wegen seiner Kleinwüchsigkeit nur Arnöldchen genannt, machte zwischen Kannen und Fässern schon früh Bekanntschaft mit geistigen Getränken, was später dazu führte, daß er von einem permanenten Durst geplagt war. Der Beifall, der ihm in der elterlichen Gaststätte entgegenschlug, wenn er die Gäste mit seinem Flötenspiel unterhielt, brachte ihn auf die Idee, seinen Unterhalt mit der Musik zu bestreiten. Dabei zog er die Tätigkeit in einem Orchester oder einer Kapelle gar nicht erst in Erwägung. Vielmehr entschied er sich spontan, die Laufbahn eines Straßenmusikanten einzuschlagen. "Wat dä Palm met dä Orgel kann, maache ich met der Fleut!", mag er sich gedacht haben. Und so begann der behäbige, untersetzte Bursche mit dem runden, rosigen Gesicht, der Stulpnase, den vergnügt und lustig zwinkernden Schlitzaugen seine Karriere auf Kölns Straßen. Fleuten-Arnöldche, wie er bald genannt wurde, war immer mit sich und der Welt zufrieden. Er wurde zur kölnischen Volksfigur mit starken Anklängen an den mittelalterlichen Narren; kein Künstler, kein geistvoller Witzling, sondern eben "nur" ein Kölner Original, dessen naive, beschränkte Lebensart das Gaudi aller hervorrief. |
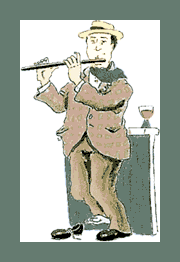 |
| Fressklötsch | |
| Orgels Palm | |
| Maler Bock | |
| Bolze Lott | |
| Schutzmann Streukooche | |
| Fleuten Arnöldche | |
  |