Uncategorised
Johann Arnold Klütsch 1778 - 1845 Althändler Taxator der Stadt Köln Hätte es vor mehr als 200 Jahren schon ein "Buch der Rekorde" gegeben, dann wäre Johann Arnold Klütsch, in Köln nur als "Fressklötsch" bekannt, darin sicherlich verzeichnet gewesen. Doch auch ohne Mithilfe des auflagenstarken Werkes ist der schwergewichtige Kölner wegen seines kaum zu stillenden Hungers und seiner Fähigkeiten, Flüssiges in ungeheuren Mengen zu schlucken, in die Lokal-Geschichte eingegangen. Die "Frankreicher" - so nannte er die 1794 in Köln einmarschierten Franzosen - bekamen des öfteren seinen Schalk zu spüren und kölsche Grielächer wußten schon zu Lebzeiten des auch als Taxator tätigen Kölners viele Geschichten über ihn zu erzählen. Wer hat sich nicht schon darüber amüsiert, daß der Fressklötsch den Zöllnern, die ihm am Eigelsteintor ein mitgeführtes Rad Holländer Käse verzollen wollten, in der Weise ein Schnippchen schlug, daß er vor den Augen der zunächst erstaunt und dann entsetzt dreinschauenden Douaniers selbigen genußvoll verzehrte und dann - sich hämisch grinsend über die Wampe streichend - in die Stadt marschierte. Bei der glänzenden Wiedergeburt des Kölner Karnevals 1823 war auch Klütsch mit von der Partie und auch am Auf- und Ausbau der freiwilligen Feuerwehr war er als "Sous-Chef der 2. Compagnie des Pompier Corps" maßgeblich beteiligt. |
 |
| Fressklötsch | |
| Orgels Palm | |
| Maler Bock | |
| Bolze Lott | |
| Schutzmann Streukooche | |
| Fleuten Arnöldche | |
  |
| Orgels-Palm Johann Joseph Palm 1801 - 1882 Husar, Militärinvalide, Orgeldreher Etwa um 1815, die Franzosen hatten gerade Köln verlassen, beginnt Johann Joseph Palm eine Lehre als Vergolder und Lackierer: er tüncht fortan Gewölbe, Altäre und Gesimse, streicht Häuser und Schuppen, vergoldet und bessert Fresken aus. Im Herbst 1820 wird er zum Leib-Husarenregiment Nr. 1, den "Schwarzen Husaren" nach Danzig eingezogen. Verwundet kehrt er nach Köln zurück und erhält - anstelle einer Rente - als "Dank des Staates" eine Orgeldreher-Konzession. Im weißverschnürten Waffenrock der "Schwarzen Husaren" bot der "Neue" ein imposantes Bild in Kölns Straßentreiben. Als seine Frau Cäcilia stirbt, heiratet er als Witwer mit vier kleinen Kindern notgedrungen sehr schnell. Doch seine "Neue", Sophia, wird den Palm'schen Pänz nicht nur eine gute Stiefmutter, sondern schenkt ihnen im Laufe der Jahre auch noch zwölf Geschwister. Zwischen 1848 und 1882 wechselt die Familie 15mal die Wohnung, achtmal innerhalb der Straße "Unter Krahnenbäumen", als "UKB" allen Kölnern ein Begriff. Tagaus, tagein wandert Palm mit seiner Orgel durch die Straßen der Kölner Altstadt, an bestimmten Tagen zieht es ihn hinüber nach Deutz, um auch dort den Klang seiner Orgel und seine Stimme ertönen zu lassen. Palm wird zur liebgewonnenen Einrichtung in der Stadt, er ist ein Stück Köln. Die Kinder laufen ihm nach, wenn er seine Runde dreht, die Erwachsenen wissen seine Darbietungen zu schätzen. |
 |
| Fressklötsch | |
| Orgels Palm | |
| Maler Bock | |
| Bolze Lott | |
| Schutzmann Streukooche | |
| Fleuten Arnöldche | |
  |
| Maler Bock Heinrich Peter Bock 1822 - 1878 Entertainer, Showman, Künstler Eigentlich sollte er das Metzgerhandwerk erlernen. Doch Heinrich Peter hatte anderes im Sinn; schon während der Schulzeit hatte er begonnen, für die Kunst zu schwärmen und sein phantasievolles Auftreten rief Ärger in der Schule, aber Heiterkeit bei der Bevölkerung hervor. Als Neunzehnjähriger zog es ihn zu den Dragonern, die in Deutz ihr Quartier hatten. Doch die Preußen, die sonst mit jedem Narren fertig wurden, hatten in ihm ihren Meister gefunden und entfernten ihn so schnell es ging. Den jungen Bock konnte das allerdings nicht verdrießen: zur Erinnerung an sein kurzes Militärgastspiel trug er fortan einen Sporn am Schuh, der ihn als "ehemaligen leichten Kavallerist" auswies. Wieder in bürgerlicher Umgebung wurde er schnell zur stadtbekannten Figur, die ihre Wohnsitze ständig wechselte. War es im Sommer die Promenade oder ein Bogen der Stadtmauer, so zog es ihn, ausgestattet mit einer guten Gesundheit, in der kälteren Jahreszeit zu einem Möbelwagen oder Kohlenkarren oder er bezog "sein Hotel", einen großen eisernen Dampfkessel, am Ufer des Rheins. Bocks gestelzte Sprache sorgte für ständige Heiterkeit insbesondere bei den Marktfrauen, deren "Star" er war. Zu jedem Geburtstag erschien Bock als Gratulant. In der rechten Hand einen selbstgepflückten Blumenstrauß, unter dem linken Arm eine Mappe, angeblich Zeichnungen und Bilder enthaltend. Gesehen hat die Bock'schen Kunstwerke niemand. Doch das war auch nicht so wichtig. |
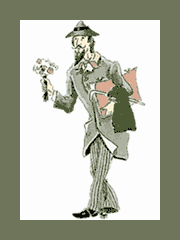 |
| Fressklötsch | |
| Orgels Palm | |
| Maler Bock | |
| Bolze Lott | |
| Schutzmann Streukooche | |
| Fleuten Arnöldche | |
  |
|
Bolze-Lott |
 |
| Fressklötsch | |
| Orgels Palm | |
| Maler Bock | |
| Bolze Lott | |
| Schutzmann Streukooche | |
| Fleuten Arnöldche | |
  |